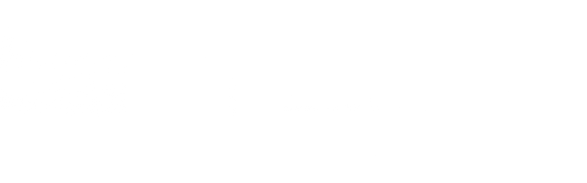Das heutige Deutschland war viele Tausend Jahre lang fast vollständig von Wald bedeckt.
 Die Geschichte und Entwicklung des Waldes in Mitteleuropa ist entsprechend eng mit der Geschichte der Menschen hier verbunden. Der Wald war Lebensraum, ernährte, bot Feuer- und Bauholz, stand aber auch für Gefahren, dunkle Mächte und abweisende Wildnis. So hat der Wald viele Mythen, Sagen und Sprichwörter in Deutschland geprägt. Heute sind Deutschlands Wälder gezähmt, die Nutzung und Entwicklung ist durchorganisiert, und für die meisten Menschen hat er vor allem noch Freizeitwert.
Die Geschichte und Entwicklung des Waldes in Mitteleuropa ist entsprechend eng mit der Geschichte der Menschen hier verbunden. Der Wald war Lebensraum, ernährte, bot Feuer- und Bauholz, stand aber auch für Gefahren, dunkle Mächte und abweisende Wildnis. So hat der Wald viele Mythen, Sagen und Sprichwörter in Deutschland geprägt. Heute sind Deutschlands Wälder gezähmt, die Nutzung und Entwicklung ist durchorganisiert, und für die meisten Menschen hat er vor allem noch Freizeitwert.
Die Geschichte von Wald und Mensch in Mitteleuropa
Interessanterweise haben sich in Mitteleuropa die heutigen Wälder von Anfang an parallel mit dem Menschen entwickelt. Das kam so: Alleine im Laufe der letzten 100.000 Jahre gab es in Europa einige Eiszeiten, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt. Als vor rund 35.000 Jahren erste „moderne Menschen“ in Mitteleuropa ankamen, herrschte auch gerade eine Eiszeit, wenn auch eine mildere Phase dieser. So war das Überleben für die ersten Menschen hier ein sehr harter Kampf und als sich das Eis vor rund 12 Tausend Jahren endgültig zurückzog, war der Mensch in dieser Gegend immer noch selten.
 Noch dramatischer waren die Folgen der jeweiligen Eiszeiten aber für die Wälder: während beispielsweise in Nordamerika bei ähnlichem Klima eine hohe Artenvielfalt an Bäumen besteht, hat in Mitteleuropa kaum eine Baumart das Eis überlebt. Schuld sind die Alpen: Zu den Höhepunkten der jeweiligen Eiszeiten, drang das ewige Eis von Nordeuropa aus langsam immer weiter Richtung Süden vor. Viele Baumarten kommen zwar durchaus mit Kälte und Winter klar, aber nur, wenn es zum Ausgleich auch eine wärmere, frostfreie Sommerperiode gibt. So wurden die Bäume zu den Eiszeiten immer enger zwischen ewigem Eis und den Alpen eingekeilt. Sobald das Eis die Alpen erreichte, war keine Rückzugsmöglichkeit, kein Lebensraum für die Bäume mehr übrig. Ohne die Alpen hätten die Baumarten sich dagegen mit dem kühleren Klima nach Südeuropa zurückziehen können, um nach dem Ende der Eiszeit wieder in Mitteleuropa heimisch zu werden. In Europa ausgestorben sind so unter anderem der Mammutbaum, Douglasien und einige Eichenarten.
Noch dramatischer waren die Folgen der jeweiligen Eiszeiten aber für die Wälder: während beispielsweise in Nordamerika bei ähnlichem Klima eine hohe Artenvielfalt an Bäumen besteht, hat in Mitteleuropa kaum eine Baumart das Eis überlebt. Schuld sind die Alpen: Zu den Höhepunkten der jeweiligen Eiszeiten, drang das ewige Eis von Nordeuropa aus langsam immer weiter Richtung Süden vor. Viele Baumarten kommen zwar durchaus mit Kälte und Winter klar, aber nur, wenn es zum Ausgleich auch eine wärmere, frostfreie Sommerperiode gibt. So wurden die Bäume zu den Eiszeiten immer enger zwischen ewigem Eis und den Alpen eingekeilt. Sobald das Eis die Alpen erreichte, war keine Rückzugsmöglichkeit, kein Lebensraum für die Bäume mehr übrig. Ohne die Alpen hätten die Baumarten sich dagegen mit dem kühleren Klima nach Südeuropa zurückziehen können, um nach dem Ende der Eiszeit wieder in Mitteleuropa heimisch zu werden. In Europa ausgestorben sind so unter anderem der Mammutbaum, Douglasien und einige Eichenarten.
Tatsächlich war Mitteleuropa, bis auf Restbestände einiger sehr kälteresistenter strauchig wachsender Birken, Polarweiden und Kiefern, am Ende der letzten Eiszeit waldfrei. Refugien für die Bäume fanden sich vor allem in Osteuropa, daneben überlebten einige Bäume im Mittelmeerraum und an manchen Teilen der Atlantikküste. Nach dem Ende der letzten Eiszeit gelang es den überlebenden Arten unterschiedlich gut und schnell, wieder in Mitteleuropa heimisch zu werden; so änderte sich die Zusammensetzung der Wälder im Laufe der kommenden Jahrtausende noch erheblich. Und gleichzeitig breitete sich mit dem Ende der Eiszeit auch der Mensch über Mitteleuropa aus.
 Als erstes gelang es Bergkiefern, dann auch Birken und Weiden, wieder großflächig in Mitteleuropa heimisch zu werden. Vor etwa 9000 Jahren war es dann warm genug, um auch z.B. Haselnuss, Eichen und Ulmen Lebensraum zu bieten. Lichte Eichenwälder und Restbestände der Birken-Kieferwälder waren die vorherrschende Waldzusammensetzung, als der Mensch langsam sesshaft wurde. Mit dem Sesshaftwerden der Menschen, ging dann auch erstmals eine größere Einflussnahme des Menschen auf die Wälder einher. Waldstücke wurden gerodet, um die Flächen für Landwirtschaft und Viehhaltung zu nutzen, und um das Holz als Brenn- und Baumaterial zu verwenden.
Als erstes gelang es Bergkiefern, dann auch Birken und Weiden, wieder großflächig in Mitteleuropa heimisch zu werden. Vor etwa 9000 Jahren war es dann warm genug, um auch z.B. Haselnuss, Eichen und Ulmen Lebensraum zu bieten. Lichte Eichenwälder und Restbestände der Birken-Kieferwälder waren die vorherrschende Waldzusammensetzung, als der Mensch langsam sesshaft wurde. Mit dem Sesshaftwerden der Menschen, ging dann auch erstmals eine größere Einflussnahme des Menschen auf die Wälder einher. Waldstücke wurden gerodet, um die Flächen für Landwirtschaft und Viehhaltung zu nutzen, und um das Holz als Brenn- und Baumaterial zu verwenden.
Noch etwas später kamen Tannen sowie Rot- und Hainbuchen zurück nach Mitteleuropa. Buchen und Tannen hatten dabei den Vorteil, relativ wenig Licht zu benötigen. So breiteten sie sich als niedere Baumschicht in den hellen Eichenmischwäldern aus und nahmen damit den jungen Eichen das Licht zum überleben. Vor rund 5000Jahren war dann die Rotbuche der am weitesten verbreitete Baum im heutigen Deutschland, die Tanne gewann in schattigen Gebirgslagen an Raum. Ohne Eingriff des Menschen, wäre dies heute noch ähnlich.
Aufschluss über die Waldzusammensetzungen früherer Jahrtausende geben unter anderem Pollenfunde, die z.B. im Torf oder im Eis gut erhalten blieben, daneben aber auch Überlieferungen über Nahrungsmittel oder Holzverwendung.
der Niedergang des Urwaldes in Mitteleuropa
Je mehr Menschen in Europa lebten und je größer der technische Fortschritt wurde, umso stärker wurde auch der Eingriff in die natürlichen Wälder.
 Immer mehr und größere Siedlungen entstanden, das Holz wurde nun auch z.B. zur Metallverhüttung und zum Bau von Schiffen gebraucht. England importierte sogar Holz aus dem Schwarzwald, nachdem der landeseigene Wald kaum mehr existent war. Holz war lange die einzige Möglichkeit, Energie, Wärme und Baumaterial zu gewinnen. Dazu standen Wälder neuen Siedlungen im Weg oder wurden als „Viehweide“ verwendet, z.B. zur Schweinemast oder als Zusatzfutter für Ziegen. Dabei wurden die Bäume und Waldflächen teils sehr selektiv genutzt, je nachdem, welches Holz zu welchem Zweck am besten geeignet war, ob die Böden zur Landwirtschaft taugten oder der Platz für eine Siedlung günstig lag. Das beeinflusste zusätzlich die Zusammensetzung der Wälder. Gezieltes Anpflanzen oder Hegen von Wäldern fand dagegen lange nicht statt. Der Wald schien den Menschen unerschöpflich.
Immer mehr und größere Siedlungen entstanden, das Holz wurde nun auch z.B. zur Metallverhüttung und zum Bau von Schiffen gebraucht. England importierte sogar Holz aus dem Schwarzwald, nachdem der landeseigene Wald kaum mehr existent war. Holz war lange die einzige Möglichkeit, Energie, Wärme und Baumaterial zu gewinnen. Dazu standen Wälder neuen Siedlungen im Weg oder wurden als „Viehweide“ verwendet, z.B. zur Schweinemast oder als Zusatzfutter für Ziegen. Dabei wurden die Bäume und Waldflächen teils sehr selektiv genutzt, je nachdem, welches Holz zu welchem Zweck am besten geeignet war, ob die Böden zur Landwirtschaft taugten oder der Platz für eine Siedlung günstig lag. Das beeinflusste zusätzlich die Zusammensetzung der Wälder. Gezieltes Anpflanzen oder Hegen von Wäldern fand dagegen lange nicht statt. Der Wald schien den Menschen unerschöpflich.
Das änderte sich im Mittelalter. Um 1300 wurde Holz mancherorten tatsächlich knapp und große, unberührte Waldgebiete waren im heutigen Deutschland kaum mehr vorhanden.
 Um 1500 waren dann in etwa so wenig Waldflächen vorhanden, wie es heute der Fall ist. Größere Waldgebiete gab es vor allem noch in den Höhenlagen der Mittelgebirge und auf Böden, die für die Landwirtschaft eher ungeeignet waren, z.B. zu lehmig oder sandig. Damit fehlte es nun mancherorten plötzlich an Dingen, die vorher selbstverständlich schienen: Brennholz, bzw. Holz als Energieträger, und Bauholz. Und die Bevölkerung wuchs weiter. Vieh wurde in Wälder getrieben, um Nahrung zu haben, Niedrigwuchs wurde als Stall-Einstreu verwendet, was zur Verödung von Böden beitrug. Gerade in Kriegszeiten wurden die Kassen gefüllt, indem Wälder abgeholzt und das Holz an Städte verkauft wurde. Weiterhin wurde viel Holz zu Kohle verarbeitet, zur Glasherstellung, Erzschmelze und ähnlichem eingesetzt. Als das Holz knapp wurde, wurde durchaus auch im späten Mittelalter schon aufgeforstet, aber nahezu ohne ökologisches Hintergrundwissen, bzw. ohne den Versuch, einen „natürlichen“ Wald wieder herzustellen. Es ging rein um eigene momentane Interessen, wie z.B. schnell eine bestimmte Holzart zu produzieren.
Um 1500 waren dann in etwa so wenig Waldflächen vorhanden, wie es heute der Fall ist. Größere Waldgebiete gab es vor allem noch in den Höhenlagen der Mittelgebirge und auf Böden, die für die Landwirtschaft eher ungeeignet waren, z.B. zu lehmig oder sandig. Damit fehlte es nun mancherorten plötzlich an Dingen, die vorher selbstverständlich schienen: Brennholz, bzw. Holz als Energieträger, und Bauholz. Und die Bevölkerung wuchs weiter. Vieh wurde in Wälder getrieben, um Nahrung zu haben, Niedrigwuchs wurde als Stall-Einstreu verwendet, was zur Verödung von Böden beitrug. Gerade in Kriegszeiten wurden die Kassen gefüllt, indem Wälder abgeholzt und das Holz an Städte verkauft wurde. Weiterhin wurde viel Holz zu Kohle verarbeitet, zur Glasherstellung, Erzschmelze und ähnlichem eingesetzt. Als das Holz knapp wurde, wurde durchaus auch im späten Mittelalter schon aufgeforstet, aber nahezu ohne ökologisches Hintergrundwissen, bzw. ohne den Versuch, einen „natürlichen“ Wald wieder herzustellen. Es ging rein um eigene momentane Interessen, wie z.B. schnell eine bestimmte Holzart zu produzieren.
Ab 1800 wurde immer deutlicher, dass ein Umdenken zwingend erforderlich war, wenn man in naher Zukunft überhaupt noch Wälder und Holz und damit Energie, Viehfutter und Baumaterial zu Verfügung haben wollte. Zudem wurde durch zunehmende Verkarstung und Verödung deutlich, wie wichtig Wald als Wasserspeicher und zur Verhinderung von Bodenerosion ist.

Buchen-Keimling
Man musste sich nun zwangsläufig damit auseinander setzen, eine Art Forstwirtschaft zu betreiben, um Wald gezielt zu produzieren und vor allem dafür zu sorgen, dass auch in Zukunft überhaupt noch Wald vorhanden sein würde. Es gab Vorgaben, Energie zu sparen und bei der Bewirtschaftung der Wälder auf Nachhaltigkeit zu setzen. Im Zuge dessen wurden z.B. so genannte „Schläge“ eingeführt, unterteilte Niedrigwälder aus Baumarten, die nach dem Abschlagen von Brennholz neu austreiben und schnell wachsen. Genutzt wurde jährlich nur ein bestimmter „Schlag“, während die restlichen in unterschiedlichen Stadien des Wachstums waren. Hierfür genutzte Baumarten waren unter anderem Hasel, Buche oder Weide.
Das Prinzip der Nachhaltigkeit war nicht leicht einzuführen, da viele Menschen von der Hand in den Mund lebten und unmittelbar davon abhängig waren, den Wald zur Ernährung der Tiere, zum heizen und bauen nutzen zu können. So dauerte es bis ins 19.Jahrhundert, bis weitflächig Waldschutzmaßnahmen und Prinzipien der Nachhaltigkeit durchgesetzt werden konnten und vor allem auch ein allgemeines Bewusstsein der Notwendigkeit dessen in der Bevölkerung entstand.
 Man darf dabei nicht übersehen, dass hier nur von Mittel-Europa geredet wird. In vielen Entwicklungsländern ist an nachhaltige Waldwirtschaft noch kaum zu denken, mit entsprechenden Folgen. Die Bevölkerung wächst stetig, der wichtige Rohstoff Wald dagegen schrumpft kontinuierlich, was natürlich auch Auswirkungen auf die Natur, auf Tiere und Pflanzengesellschaften hat. Es kommt zur Verkarstung, da der Wald als Bodenschutz fehlt und auch auf die globale Klimaänderung nimmt es Einfluss. Gefragt sind da ebenfalls die „reichen“ Länder: Wälder werden auch deshalb abgeholzt, weil die Nachfrage nach billigem Futter für die Tiermast, nach Soja, Ölpalme, Mais und ähnlichem groß ist. Es braucht Alternativen für Menschen, die immer noch von der Hand in den Mund leben, Brennholz brauchen, landwirtschaftliche Flächen und irgendwas, um ein Grundeinkommen zu haben. Eine Selbstverständlichkeit sollte es zudem sein, Tropenholz nur aus nachhaltigem Anbau zu kaufen.
Man darf dabei nicht übersehen, dass hier nur von Mittel-Europa geredet wird. In vielen Entwicklungsländern ist an nachhaltige Waldwirtschaft noch kaum zu denken, mit entsprechenden Folgen. Die Bevölkerung wächst stetig, der wichtige Rohstoff Wald dagegen schrumpft kontinuierlich, was natürlich auch Auswirkungen auf die Natur, auf Tiere und Pflanzengesellschaften hat. Es kommt zur Verkarstung, da der Wald als Bodenschutz fehlt und auch auf die globale Klimaänderung nimmt es Einfluss. Gefragt sind da ebenfalls die „reichen“ Länder: Wälder werden auch deshalb abgeholzt, weil die Nachfrage nach billigem Futter für die Tiermast, nach Soja, Ölpalme, Mais und ähnlichem groß ist. Es braucht Alternativen für Menschen, die immer noch von der Hand in den Mund leben, Brennholz brauchen, landwirtschaftliche Flächen und irgendwas, um ein Grundeinkommen zu haben. Eine Selbstverständlichkeit sollte es zudem sein, Tropenholz nur aus nachhaltigem Anbau zu kaufen.
Der Wald in Mitteleuropa im 19. bis 20. Jahrhundert
Langsam änderte sich die Einstellung der Menschen dem Wald gegenüber. Auf der einen Seite stand der Wald nun auch im Sinne der „Romantik“ im Positiven für Naturnähe, zum anderen setzte sich endgültig das Prinzip der Nachhaltigkeit durch.

Buche
Der Begriff der Nachhaltigkeit wird konkret Hans Carl von Carlowitz zugeschrieben, der formulierte, dem Wald dürfe nur so viel Holz entnommen werden, wie im gleichen Zeitraum nachwachsen könne. Man lebt quasi nur von den Zinsen (dem, was jedes Jahr im gleichen Zeitraum nachwächst) und lässt das Grundkapital stehen. Dadurch erhält man den Wald für kommende Generationen, auch wenn das eine momentane Einschränkung bedeuten kann. Dass der Spagat zwischen Nutzbarkeit des Waldes und Erhalt der natürlichen Gegebenheiten nicht ganz einfach ist, zieht sich allerdings bis in die Gegenwart durch. Man denke an die riesigen Flächen von künstlich angepflanzten Fichten- oder Kiefern-Monokulturen.
Ab etwa 1800 fand eine gezielte Ausbildung zum Forstwirt an Hochschulen statt. Dabei wurden nun auch Aspekten wie dem gezielten Schutz bestimmter Biotope, dem Beachten von natürlichen Pflanzengesellschaften, Schutzfunktionen der Wälder und Boden- und Raumansprüchen der einzelnen Bäume vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Auch dies war allerdings ein langsamer Prozess, mit vielen Rückschlägen. Wie „natürlich“ darf ein Wald sein? Wie wichtig ist „Totholz“? Macht es Sinn, Arten aus anderen Ländern in unsere Natur einzubringen?
Die Industrialisierung brachte nun auch neue Möglichkeiten, unabhängiger vom Wald zu werden. Es wurde zunehmend Braun- und Steinkohle abgebaut, künstlicher Dünger führte zu höheren landwirtschaftlichen Erträgen und Waren konnten, u.a. durch die Eisenbahn, über weitere Strecken transportiert werden. Immer mehr Menschen arbeiteten in Fabriken, in Städten, und nicht mehr als Selbstversorger von Viehhaltung, Landwirtschaft und unmittelbarer Nutzung der Dorfwälder. Das Forstwissen wuchs dabei weiter.

Fichtenforst
Ein herber Rückschlag für den deutschen Wald kam in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Viel Wald wurde während der Kriege vernichtet, im dritten Reich als Baumaterial ausgebeutet und schließlich nach dem 2. Weltkrieg als Teil von Reparationszahlungen abgeholzt. Im Anschluss daran wurde versucht, so schnell wie möglich wieder aufzuforsten. Leider war dies verbunden mit der massenhaften Pflanzung von schnell wachsenden Monokulturen. Die neuen Wälder waren durchorganisiert, standen in Reih und Glied, dicht gepflanzt für schnellen Ertrag, Unterholz wurde zügig entfernt. Aufgeräumt und effektiv sollte es sein. Vor allem Fichten sind hierzu verwendet worden, die recht anspruchslos und vor allem schnellwachsend sind.
Leider sind solche Monokulturen auch recht anfällig für Schädlinge und beherbergen nur wenige unterschiedliche Tier- und Insektenarten. Auf Fichten spezialisierte „Schädlinge“ haben natürlich das Paradies auf Erden, leider finden ihre natürlichen Fressfeinde aber kaum geeignete Lebensbedingungen. Abgestorbene Bäume, Unterholz und Niederwuchs, die als Lebensraum und Nahrungsgrundlage für z.B. kleine Säuger, Vögel und Insekten hätten dienen können und auch als Wasserspeicher und Humus fungieren, waren allgemein unerwünscht.

Bodenbewuchs braucht Licht
In den 1980er Jahren war es dann in aller Munde: Deutschlands Wälder sterben. Saurer Regen und zu viel falscher Einfluss des Menschen haben dem Wald sehr viel mehr Schaden zugefügt, als man für möglich gehalten hätte. Initiativen zur Rettung der Wälder, Diskussionen in den Medien und ökologische Forschungen führten langsam zu einem Umdenken und neuen Ansätzen in der Fortwirtschaft. Maßnahmen zur Eindämmung der Umweltverschmutzung wurden ergriffen, vor allem der Ausstoß von Schwefeldioxid wurde drastisch reduziert und so unter anderem der Katalysator für PKW eingeführt. Dazu sind seitdem naturnahe Mischwälder wieder im Kommen und abgestorbene Bäume werden nicht mehr in erster Linie als „Schädlingsbrutstätte“ gesehen, sondern auch als Lebensraum und wichtiger Teil des Wald-Zyklus. So lässt sich heute wieder an einigen Orten Deutschlands „Märchenwaldstimmung“ erleben. Laubwälder, vor allem naturnahe Buchenwälder, haben zugenommen, der Fichtenbestand hat abgenommen.